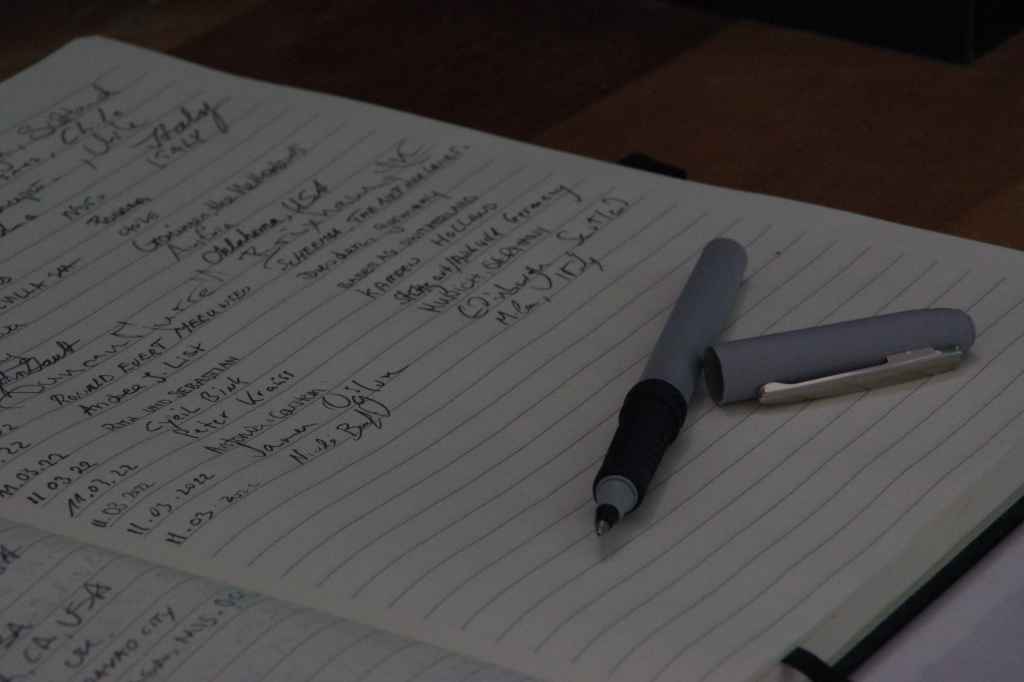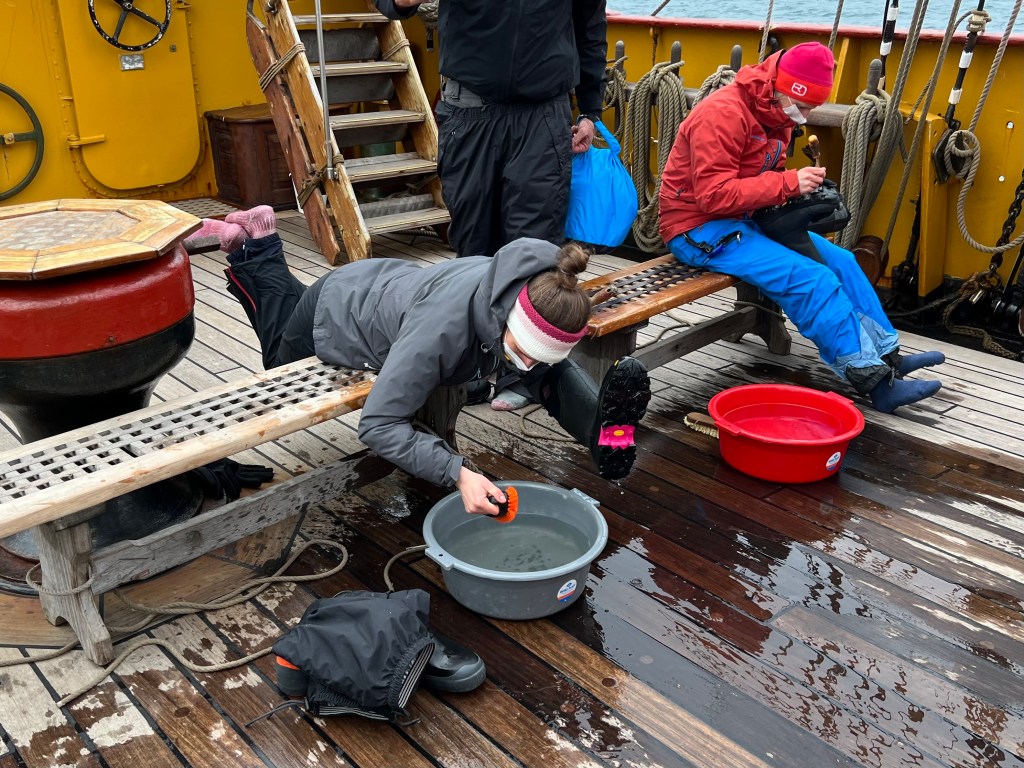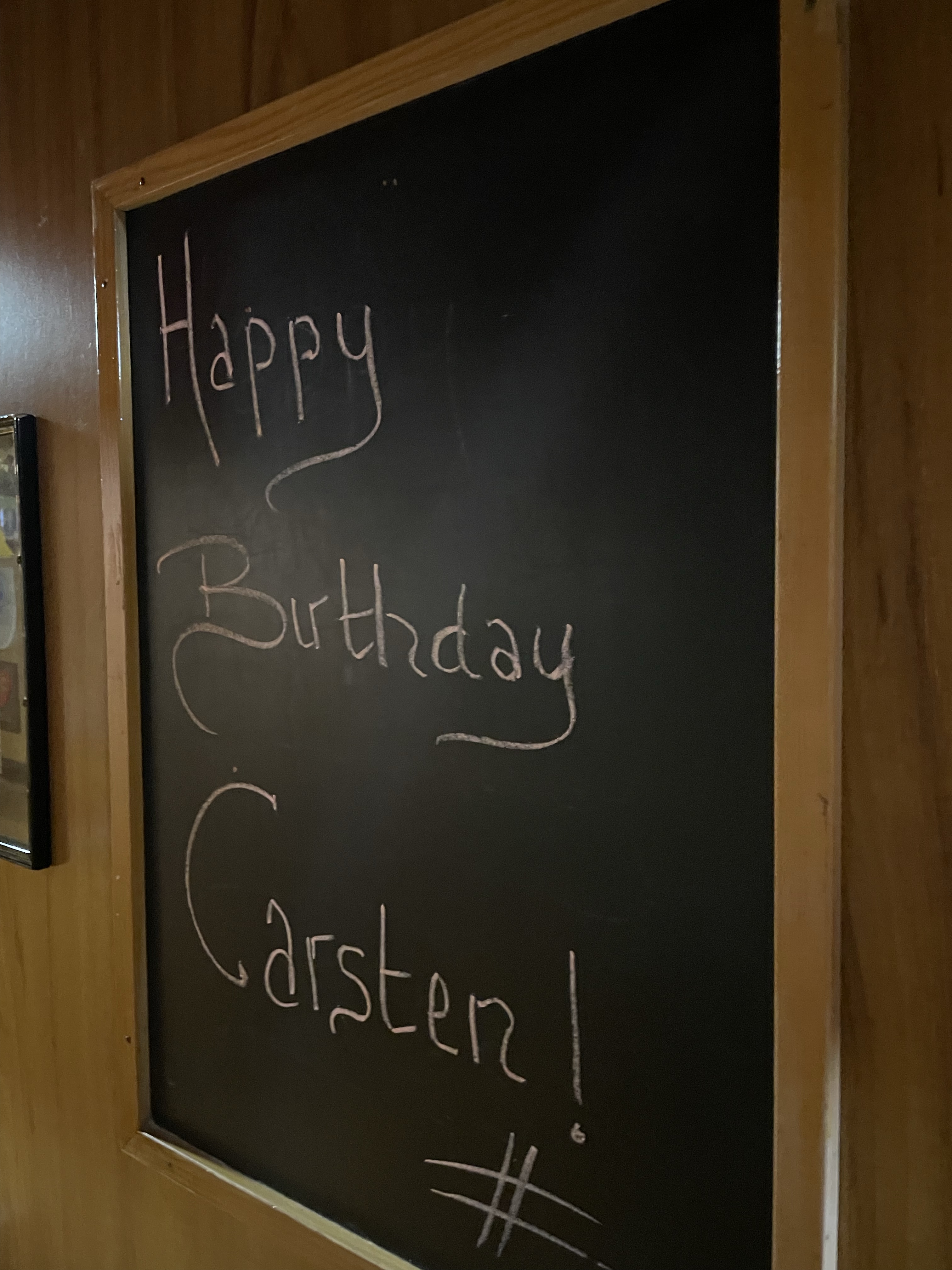Auf einmal waren wir in Windhoek. Nur noch zu zweit. Ohne Plan. Ohne Routine. Und ohne Ziel. Klar war nur, dass wir genau zwei Wochen hatten, um dieses Land kennen zu lernen. Und eigentlich brauchten wir noch Zeit, um richtig anzukommen. Es war der 10. April.
Reiseplanung für Fortgeschrittene
Eine erste Überraschung erwartete uns bei der Ausreise aus Kapstadt. Der zuständige Beamte fragte nach unserem Reiseziel. Als er fragte, wo es nach Namibia hingehen sollte und mit der Antwort „world“ nicht vollständig zufriedengestellt war, erläuterten wir unsere nächsten Reisepläne, die beinhalteten einen unbestimmten Zeitraum in Südafrika zu verbringen. Daraufhin erklärte uns der Beamte, dass wir bei einer Wiedereinreise nach Südafrika nur ein Visum über sieben Tage bekommen würden. Diese Information nahmen wir also mit nach Windhoek und kontaktierten gleich die beiden Pärchen, die mit uns auf der Bark Europa gewesen waren und ebenfalls planten, nach Südafrika zurückzukommen. In der Folge informierten sich alle bei Botschaften und Konsulaten in der Heimat und kamen aufgrund inkonsistenter Datenlage zu dem Ergebnis, dass die Dauer des Visums für Südafrika nach der Wiedereinreise eine Art Glücksspiel werden würde. Auf dieses Spiel wollten wir uns nicht einlassen, weshalb wir unsere Südafrikapläne kurzerhand (Achtung: schiffsbezogenes Wortspiel) über Bord warfen und nun zwei Wochen Zeit hatten, neue Pläne zu schmieden. Obwohl wir uns eigentlich jedes Mal intensiv mit den Einreisebegebenheiten auseinandersetzen (was sich in Zeiten von Corona als gar nicht mal so einfach herausgestellt hat), kam diese Hürde aus dem Nichts und ließ uns beim Bereisen des ersten Landes schon ein wenig zweifeln, ob spontan Reisen wirklich reibungslos funktionierende würde.
Wie schön kann eigentlich die Sonne untergehen?
Am Flughafen Windhoek angekommen, die nächste Überraschung. Relativ unbegleitet liefen wir über das Flugfeld zum Terminal. Obwohl wir auf hoher See den ein oder anderen wunderschönen Sonnenuntergang erleben durften und sich in den zwei Tagen in Südafrika schon angedeutet hatte, welches Spektakel sich allabendlich abspielen kann, wurden wir vom bisher schönsten Sonnenuntergang begrüßt (dies galt zumindest für Carsten; Toni erinnerte sich an frühere Familienurlaube in Kenia). Wir waren sprachlos ob des Farbenspiels, welches den Himmel über eine gefühlte Ewigkeit in immer wieder unterschiedliche Töne malte. Der Gesamteindruck lässt sich durch Bilder leider nicht annähernd vermitteln. Wir freuen uns für jeden, der die Chance hat, eine solche Erfahrung selbst gemacht zu haben oder zu machen. Für uns werden diese Farben und dieses Gefühl von nun an untrennbar mit Afrika verbunden bleiben. Allein der Gedanke daran sorgt zukünftig sicherlich für das ein oder andere feuchte Auge. (Wir wissen nicht, wo man in Namibia die Region Afrika begrenzt. Als wir die Frage, ob wir schon einmal in Afrika gewesen wären, mit „Ja, in Ägypten“ beantworteten, bekamen wir zumindest die Reaktion, dass das ja nicht Afrika sei).
Windhoek
Die Taxifahrt vom Flughafen zu unserer Unterkunft dauerte ungefähr eine Stunde und wir genossen weiterhin den Sonnenuntergang. Sobald wir angekommen waren, begannen die Reiseplanungen. Toni hatte schon kurz recherchiert und herausgefunden, dass man dieses Land wohl relativ unproblematisch auf eigene Faust erkunden konnte. Also entschlossen wir uns, ein paar Tage in Windhoek zu bleiben, um von dort weitere Einzelheiten zu klären. Daneben wollten wir noch Sachen erwerben, die beim Packen für die Antarktis keine Berücksichtigung gefunden hatten, wie z.B. kurze Hosen, leichte Sommerschuhe und normale Alltagskleidung, damit man nicht immer gleich als deutscher Tourist erkannt wurde (in Afrika, haha). Erstaunlicherweise gestaltete es sich zumindest für Toni als unmöglich, eine kurze Hose zu erwerben, wofür es mehrere Gründe gegeben haben mochte. Der Hauptgrund lag sicherlich darin, dass der Wintereinbruch kurz bevor stand und die Regale eher mit Daunenmänteln als mit kurzen Hosen gefüllt waren. Glücklicherweise fand sie dann doch einen adäquaten Ersatz für eine kurze Hose in Form eines Kleids. Fast genauso unmöglich war es, einen fahrbaren Untersatz zu mieten, mit dem wir uns auf Erkundung begeben konnten. Nach 17 erfolglosen Telefonaten mit Mietwagenunternehmen, die alle bereits ausgebucht waren, konnte Toni beim 18. Telefonat wenigstens einen Teilerfolg erzielen, da ihr ein Wagen für eine Woche angeboten wurde. Wir nahmen also den Spatz auf dem Dach, buchten den Wagen und planten eine kleinere Tour als erhofft. Zudem schlenderten wir ein wenig durch das herbstlich heiße Windhoek und ließen die Eindrücke einfach auf uns wirken.





Wir freuten uns auch über ein Wiedersehen mit Kabine 10, da Eva und Bas ebenfalls für eine Rundtour nach Namibia geflogen waren. Die kurioseste Begegnung waren aber vermutlich die „DDR-Kinder“, die uns wiederholt über den Weg liefen und jedes Mal um „Spenden“ für eine große Veranstaltung baten, die schon bald stattfinden sollte. Bei der Recherche zu den „DDR-Kindern“ gewannen wir die ersten Einblicke in die Geschichte Namibias und unser Interesse war mehr als geweckt. Wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, welche Entwicklung dieses Land in den letzten 150 Jahren durchmachen musste, welche Konflikte es ertragen, welchen Einflüssen es sich erwehren und welchen Zwängen es entwachsen musste und wie viel davon sich noch heute auf die Gegenwart auswirkt. Wir hatten den Wunsch, das Land ganzheitlich zu erfahren.
Von der Hochebene zur Küste (Walvis Bay)
Nach drei Tagen in Windhoek tauschten wir vier Wände gegen vier Räder,
Bett gegen Matratze, Bettwäsche gegen Schlafsack, Herd gegen Gaskocher und Stadt gegen Land. O.k. wir hatten noch zwei Reserveräder, jedoch keinen Reservekanister, dabei. Es sollte ja nur eine kleine Tour auf (unserer Einschätzung nach) weitgehend touristisch erschlossenen Gebieten werden.
Nach einer kurzen Einweisung fuhren wir los in Richtung Walvis Bay. Bei der Routenplanung mussten wir berücksichtigen, dass wir nach Sonnenuntergang nicht mehr unterwegs sein durften, die Distanzen aber doch meist ordentlich waren. Nach einem Tankstop, einem kurzen Einkauf und mehreren Panikattacken der Beifahrerin hatten wir uns schnell an Auto und Linksverkehr gewöhnt und kamen gerade so rechtzeitig an unser erstes Etappenziel.
Neue Erfahrung: Tanken. Wir hatten im Vorfeld gelesen, wie es funktioniert, fragten uns dann aber doch z.B. – insbesondere weil wir gerade aus Südafrika kamen – ob man aussteigt, ob man die Tür verriegelt oder ob man mit Kreditkarte zahlen sollte. Letztere Frage erledigte sich wegen der Menge von 135 Litern, die wir tankten, glücklicherweise von selbst (bei ca. 1,25 Euro pro Liter), so dass wir schnell mehr Vertrauen fassten.
Im Vergleich zu Windhoek war es abends schnell sehr frisch und schon beim Aufbauen des Zeltes fröstelten wir ein bisschen.

Durch die Wüste die Küste entlang nach Swakopmund
Am nächsten Morgen schliefen wir aus und gingen nach einem ausgiebigen Frühstück am leeren Strand von Walvis Bay spazieren. Am Vormittag war es tatsächlich herbstlich kühl.
Neue Erfahrung: Parkwächter. Auch hier hatten wir natürlich gelesen, wie es funktioniert, aber es war dennoch spannend, über Sinn dieser Institution zu diskutieren – wie es vermutlich jeder Tourist macht, der das das erste Mal sieht. Sofort stellten wir uns die Frage, wie man reagiert hätte, wenn man nicht die Chance hat, sich vorab zu informieren (wie ist man eigentlich in Zeiten vor dem Internet auf eigene Faust gereist???).
Wir genossen die durch die Feiertage bedingte Einsamkeit und trafen auf Flamingos in freier Wildbahn.

Die nächste neue Erfahrung: Eine Gruppe junger Männer wollte Fotos und Selfies mit uns. Sofort schrillten sämtliche Warnglocken und wir zierten uns etwas, ließen uns aber schließlich doch darauf ein. Die Gruppe junger Männer war sichtlich glücklich über den Gefallen und wir alle lachten viel. Sie erzählten uns, dass sie aus Zimbabwe zum Urlaub hier wären. Wir fühlten uns wegen unserer ersten negativen Gedanken nicht wirklich gut und fragen uns immer noch, ob wir vorurteilsbehaftet oder einfach nur vorsichtig waren. Oder ob es hier gar keinen Unterschied gibt, weil unser Verhalten ja nur auf das im Vorfeld Gelesene zurückzuführen war.
Da wir es aufgrund der Autoknappheit der Vermietungsfirmen nicht weiter in den Süden schaffen würden, unser nächstes Ziel (Swakopmund) ohnehin nicht allzu weit entfernt war und wir somit noch ausreichend erlaubte Autozeit zur Verfügung hatten, machten wir anschließend einen Abstecher zu einer der Sanddünen, für die Namibia weltbekannt ist. Wir wissen nicht, ob es an den Osterfeiertagen lag, aber als wir ankamen, fanden wir ein sehr angenehmes Setting vor. Alle Freizeitaktivitätsanbieter, wie z.B. von Sandsurfen, hatten geschlossen und anstelle von Touristenmassen schienen viele der Leute, die dort waren, aus der näheren Umgebung für einen Feiertagsausflug gekommen zu sein. Vor den Autos wurde entspannt gegrillt, Kinder spielten ausgelassen und überall lief laute Musik. Natürlich erkletterten wir die Düne und genossen den Ausblick. Sollten wir jemals wieder nach Namibia kommen, werden wir auf jeden Fall versuchen, einen Sonnenaufgang in den südlicheren Dünen zu erleben.






Der weitere Weg nach Swakopmund führte entlang der Küstenstraße und wir kamen entspannt an, um wieder mal einen Sonnenuntergang am Meer verfolgen zu können. Unbezahlbar.

Into the wild (Spitzkoppe)
Unsere nächste Etappe führte uns in die Wildnis. Nachdem wir uns nun ausreichend in die Campingabläufe eingegroovt hatten, war es an der Zeit, etwas abseits von den größeren Siedlungsgebieten zu übernachten.
Zuvor erkundeten wir noch ein wenig Swakopmund, wo uns vor allem das historische Museum sehr gefiel, mal wieder zum Nachdenken anregte und genug Stoff für angeregte Unterhaltungen lieferte. Aufgrund der vergangenen kühlen Nächte erwarben wir noch eine Decke, die wir jedoch nicht mehr brauchen würden.
Neue Erfahrung: gravel road, die die Mehrheit des Straßenbelags in Namibia ausmacht. Tip: Bei häufigen Wechseln des Straßenuntergrundes ist ein vernünftiger Kompressor sehr hilfreich.


Spät Abends (die Fahrverbotsampel hätte irgendwas zwischen gelb und rot angezeigt) erreichten wir Spitzkoppe und durften/mussten irgendwo im Nirgendwo campen („we are booked out but just look for a place where you want to stay…“). Die Kulisse war traumhaft und wir hatten Glück, dass wir dank des hell leuchtenden Vollmondes nicht im Dunkeln aufbauen mussten.


Safari
Trotz einer längeren Fahrtstrecke vor uns ließen wir es uns am nächsten Tag nicht nehmen, das abgeschieden gelegene Wander- und Klettergebiet im Naturschutzpark Spitzkoppe zu erkunden. Ein Guide der San begleitete uns zu tausend Jahre alten Höhlenmalereien und erklärte anhand dieser einführend die Geschichte und Kultur seines Volkes. Es entspann sich eine interessante Diskussion um gesellschaftliche Werte, Interessen und Generationenkonflikte und schnell war klar, dass das Leben im Busch schon lange nicht mehr vollständig unbeeinflusst von den Auswirkungen der modernen Zivilisation stattfinden kann.
Beeindruckt von der Kultur der San, wobei uns deren nach den Erzählungen friedliche Koexistenz untereinander im Einklang mit der Natur besonders gut gefiel („not like Ukraine and Russia“), machten wir uns auf den Weg in den Nationalpark Etosha, wo wir zwei aufregende Tage verbrachten.









Windhoek
Unser Safariabenteuer war viel zu schnell beendet und wir mussten uns nach der einen Woche von unserem neuen Zuhause trennen. Wie viele Trennungen verlief das Ganze nicht reibungslos. Auf der Rückfahrt reagierte plötzlich das Gaspedal nicht mehr, wir blieben stehen und hatten noch Glück, dass wir auf einem 30 Meter langen „Standstreifen“ ausrollen lassen konnten. Der Standstreifen selbst war in jede Richtung 75 Kilometer von einer Stadt entfernt. Alle von uns überprüfbaren Parameter (Öl, Hydraulik, Kühler, Batterie) waren im grünen Bereich und der Tank war laut Anzeige noch zu knapp einem Viertel gefüllt. Der von uns angerufene Service vermutete einen Lufteinschluss und aufgrund dessen einen leeren Tank. Da er in der Nähe keinen Mechaniker erreichen konnte, bat er uns, ca. 2 Stunden zu warten, bis Hilfe ankommen würde, denn er müsse erst einen Mechaniker in Windhoek auftreiben.

Zugegebenermaßen gibt es schlechtere Orte für eine solche „Panne“ und der Luftzug konnte die ausgefallene Klimaanlage halbwegs ersetzen. Dennoch vertrauten wir nicht so ganz auf afrikanische zwei Stunden und nahmen unser Schicksal selbst in die Hand. Zufälligerweise befand sich genau gegenüber unserem Standstreifen das Gate zu einer Jagd-&Gästefarm, auf der wir zurecht einen Kanister Diesel vermuten durften. Nach kurzer Internetrecherche kontaktierten auf gut Glück den Besitzer der Farm. Anscheinend hatten wir genug Karmapunkte gesammelt, denn der Besitzer hatte noch Diesel vorrätig und schickte uns Detlef vorbei, einen gut gelaunten Rentner aus Deutschland, der jedes Jahr ein paar Wochen Urlaub auf der Farm verbrachte. Detlef half uns beim Befüllen des Tanks und sah uns zu, wie wir uns bemühten, die Dieselleitungen gemäß den telefonischen Anweisungen des Mechanikers zu entlüften und den Wagen zu starten. Als dies nach mehrfachen Versuchen endlich klappte, war Detlef fast genauso happy wie wir. Wir verabschiedeten uns mit einem Lächeln und konnten unsere Fahrt getränkt von Schweiß und Diesel fortsetzen. Froh, auch dieses Abenteuer schadlos überstanden zu haben und unheimlich dankbar, in dieser fremden Gegend auf solch nette Menschen getroffen zu sein.

„We have basically just returned from Swakopmund so you can imagine our surprise when we received this lovely letter which we have passed onto Detlef (our much liked and trustworthy guest of many years). Detlef has a way of making a horrible situation into something to smile about. We are thrilled that Outeniqua could be of help and that your next trip to Namibia will be with an open heart and not dread.
Do take care and I do hope Namibia sees you again in the future.“
–
Auszug aus der Antwort nachdem wir uns noch einmal per E-Mail für die Unterstützung der Outeniqua Jagd- und Gästefarm bedankt haben
Die Stadt, in der ich nicht leben möchte
In Windhoek nahmen wir an einer empfehlenswerten Stadtführung teil. Unser guide Petrus erklärte ausführlich die historischen Zusammenhänge, die die Stadt und das Land zu dem gemacht haben, was es heute ist. Unheimlich spannend. Und insbesondere vor dem aktuellen weltpolitischen Geschehen unglaublich traurig, wie Menschen trotz des angeblich hohen Zivilisationsgrades immer wieder Gewalt anwenden und damit über Generationen ein friedliches Zusammenleben unmöglich machen.
Dank Petrus lernten wir auch Kattutura kennen, das township von Windhoek. Trotz des Namens, der aus der Zeit der Zwangsumsiedelungen herrührt und so viel bedeutet wie „die Stadt, in der ich nicht leben möchte“, fühlen sich laut Aussage von Petrus unheimlich viele der Bewohner hier inzwischen sehr wohl und möchten gar nicht mehr wegziehen, selbst wenn die finanziellen Mittel für einen Umzug vorhanden wären.

Happy Birthday (oder auch: warum wir ab jetzt überlegen, in fremden Ländern unser GPS auch auf vorgegebenen Wanderwegen zu nutzen)
Tonis Geburtstag verbrachten wir zunächst im Namibian Craft Center, in dem wir glücklicherweise endlich fündig wurden, was die entsprechenden Geschenke betrifft (der favorisierte Edelstein im Kristallmuseum von Swakopmund überstieg leider das Reisebudget).


Anschließend fuhren wir auf eine Farm in der Nähe von Windhoek, wo wir – im Gegensatz zum Etosha-Nationalpark – in freier Wildbahn wandern konnten. Wir machten eine kleine Wanderung und ließen uns aufgrund der guten Erfahrung am nächsten Tag gleich auf die große Wanderung ein, welche sich zu einem ungeplanten Abenteuer entwickelte. Wir gehen davon aus, irgendwann einmal vom nicht mehr erkennbaren Weg falsch abgebogen zu sein und sagen wir es mal kurz zusammengefasst so: Auch hier sind wir froh, schadlos und zeitnah an unserem Ausgangspunkt angekommen zu sein 😜. Den Abend ließen wir bei einem klassischen Marathon-Hühnchen auf namibianische Weise ausklingen und machten uns am nächsten Tag (24.04.) wohlbehalten, wohlgenährt und endlich mal wieder etwas ausgepowert in Richtung Südafrika auf.





Wir wären sehr gerne länger in Namibia geblieben, insbesondere um uns noch die Wüste im Südwesten anzusehen. Auch wären wir gerne noch weiter in den Norden gefahren, um vielleicht die Grenze zu Botswana zu passieren. Aber unser zeitlicher Plan ließ das nicht zu. Wir können für dieses wunderschöne und freundliche Land jedenfalls eine uneingeschränkte Reiseempfehlung aussprechen. Besonders hat uns gefallen, dass es unkompliziert möglich ist, auf eigene Faust im eigenen Rhythmus zu reisen.